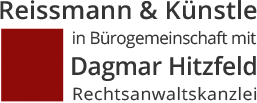Aktuelles
Welche Unterhaltspflichten haben die Eltern volljähriger Kinder?
Ein Volljähriger ist grundsätzlich selbst dafür verantwortlich, wie er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Wenn sich ein Volljähriger aber z.B. noch in der Ausbildung befindet, sind die Eltern weiterhin unterhaltspflichtig.
In welchen konkreten Fällen das zutrifft, haben wir hier für Sie aufgelistet:
- Volljährige Kinder, die sich noch in der Schule, im Studium oder in einer Berufsausbildung befinden, bekommen ihren Unterhalt und die Ausbildungskosten von den Eltern finanziert. Darauf haben sie nach § 1610 Abs. 2 BGB ein Recht. Wenn Jugendliche allerdings parallel zu Schule oder Ausbildung noch jobben oder ein Lehrlingsgehalt bekommen, wird dies auf den Unterhaltsanspruch angerechnet. Auch Kindergeld, BAföG und eventuelle Stipendien werden mit dem Unterhaltsanspruch verrechnet. Die Eltern sind lediglich zur Finanzierung der ersten Ausbildung verpflichtet. Weitere Berufsausbildungen müssen sie nicht bezahlen. Bei Lehrstellenwechsel bleiben die Eltern unterhaltspflichtig.
- Einige Monate im Ausland, z.B. im Rahmen eines Au-Pair-Aufenthaltes, müssen nicht von den Eltern bezahlt werden.
- Volljährige Kinder, die keine Ausbildung machen, sondern bereits eine Arbeitsstelle haben, bekommen im Falle von Arbeitslosigkeit Unterhalt von den Eltern. Dabei müssen sie aber nachweisen, dass sie keine neue Arbeitsstelle finden, aber es kann durchaus auch eine fachfremde Arbeitsstelle sein oder ein Arbeitsplatz, der – nach Ansicht des Betroffenen – unter seinem fachlichen Niveau liegt.
- Kranke oder behinderte Kinder, die nicht erwerbstätig sein können, haben auch als Volljährige einen Anspruch auf Unterhaltszahlungen der Eltern. Hier gibt es Unterstützung durch den Staat und andere Stellen, worüber sich die betroffenen Eltern unbedingt informieren sollten.
Sie haben ein volljähriges Kind und wollen gerne wissen, in welchem Umfang Sie unterhaltspflichtig sind? Fragen Sie Rechtsanwältin Dagmar Hitzfeld in unserer Kanzlei in Lörrach. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht und wird Ihnen kompetent weiterhelfen. Vereinbaren Sie einen Termin!
Versehentliche Beschädigung an einem parkenden Auto: Reicht es, wenn ich einen Zettel mit meiner Adresse an der Windschutzscheibe hinterlasse?
Aus anwaltlicher Sicht sagen wir: Nein, Vorsicht, das reicht nicht!
Die Situation ist recht häufig: Auf einem Parkplatz, beim Öffnen der Fahrzeugtüren, beim Rangieren in engen Parklücken, bei der Durchfahrt durch schmale Gassen kommt es leicht dazu, dass man versehentlich ein parkendes Fahrzeug beschädigt.
Korrektes Vorgehen ist nun, mit dem geschädigten Fahrzeughalter zu sprechen, die Adressen auszutauschen und die Haftpflichtversicherung zu informieren.
Doch was ist zu tun, wenn der Fahrzeughalter nicht in der Nähe ist und man nicht am beschädigten Auto warten kann?
Weggehen ist ein Straftatbestand – so steht es im Gesetz. Nach § 142 StGB muss derjenige, der den Schaden verursacht hat, „angemessen lange“ am geschädigten Fahrzeug auf dessen Besitzer warten. „Angemessen lange“ ist nicht sehr konkret, in der Regel ist damit rund eine Stunde als zumutbare Wartezeit gemeint.
Der Unfallverursacher kann auch die nächste Polizeidienststelle aufsuchen und dort den Schaden melden. Dies wäre genauso richtig.
Der Schadensort darf nur in einem Fall sofort verlassen werden: Wenn nämlich jemand verletzt wurde und dringend ärztlich versorgt werden muss. Dann darf der Unfallverursacher mit ihm zum nächsten Arzt fahren, muss aber dennoch schnellstmöglich auf der Polizei Meldung über den Schaden machen.
In unserer Kanzlei in Lörrach können Sie sich bei Fragen zum Verkehrsrecht gerne an die Rechtsanwälte Herwig Reissmann oder Hannes Künstle wenden. Sie helfen Ihnen kompetent weiter.
Wie ist die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall im Arbeitsrecht geregelt?
Das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) schreibt vor, dass ein kranker Arbeitnehmer noch sechs Wochen lang sein normales Gehalt bekommen muss. Wenn sich die Krankheitszeit länger als sechs Wochen hinzieht und wenn es sich um dieselbe Erkrankung handelt, bezahlt die Gesetzliche Krankenkasse das so genannte „Krankengeld“. Hierfür sind die Bescheinigungen des Arztes – zunächst die Erstbescheinigung, dann die Folgebescheinigungen, bei der Krankenkasse einzureichen. Das Krankengeld ist nicht so hoch wie das normale Gehalt: Es beträgt 70% des Bruttoverdienstes. Das Krankengeld wird bis zu 78 Wochen lang ausbezahlt.
Es kommt jedoch vor, dass ein Arbeitnehmer sechs Wochen lang krankgeschrieben ist, dann wenige Tage wieder zur Arbeit kommt und sich daraufhin eine neue Erstbescheinigung beim Arzt ausstellen lässt. Dann ist der Arbeitgeber wieder zur vollen Lohnzahlung verpflichtet. Ein Arbeitgeber klagte in einem solchen Fall. Das Bundesarbeitsgericht urteilte hier zu Gunsten des Arbeitgebers (Az. 5 AZR 318/15, Urteil vom 25.05.2016). Warum?
Im vorliegenden Fall konnte nicht belegt werden, dass die neuerliche Krankschreibung, die von einem Facharzt ausgestellt worden war, nicht wegen derselben Krankheit ausgestellt worden war. Laut Gesetz muss der Arbeitnehmer zwischen zwei Erstbescheinigungen tatsächlich arbeitsfähig gewesen sein.
Welche Folgen hat dieses Urteil? Wenn ein Arbeitnehmer nach Ablauf einer Krankheitsphase gleich wieder eine Krankmeldung vorlegt, muss er dem Arbeitgeber beweisen können, dass er vollständig von seiner ersten Erkrankung genesen war.
Wenn sie Rat und Unterstützung in arbeitsrechtlichen Fragen benötigen, wenden Sie sich in unserer Kanzlei in Lörrach gerne an die Rechtsanwälte Herwig Reissmann oder Hannes Künstle. Sie helfen Ihnen gerne weiter!