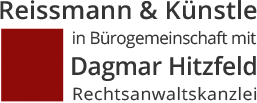Aktuelles
Arbeitsrecht: Diebstahl von Desinfektionsmittel rechtfertigt fristlose Kündigung
Desinfektionsmittel ist in Corona-Zeiten ein begehrtes Gut. Nachdem bei einem Paketzusteller immer wieder Desinfektionsmittel verschwand, hatte die Betriebsleitung in den Sanitärräumen ein Schild anbringen lassen, dass der Diebstahl von Desinfektionsmittel die fristlose Kündigung nach sich ziehe. Das nützte offenbar nichts: Ein Arbeitnehmer, der seit vielen Jahren als Fahrzeugwäscher und Ladehelfer beim Unternehmen angestellt war, wurde bei einer Kontrolle seines privaten PKW ertappt: Im Kofferraum lag eine noch versiegelte Literflasche Desinfektionsmittel sowie eine Rolle mit Papiertüchern – alles zusammen im Wert von rund 40 Euro. Der Mitarbeiter wurde sofort fristlos entlassen.
Er klagte und gab an, das Desinfektionsmittel für seine Kollegen und sich selbst im Auto deponiert zu haben, damit er sich während des Tages ab und zu die Hände desinfizieren könne. Außerdem habe er es nicht nötig, Desinfektionsmittel zu stehlen, da seine Frau in der Pflege arbeite und er deshalb ganz leicht an Desinfektionsmittel für den privaten Gebrauch käme. Die Richter am Landesarbeitsgericht Düsseldorf glaubten seinen Ausführungen nicht. Der Diebstahl sei ein wichtiger Grund für die fristlose Kündigung, deshalb sei diese gerechtfertigt (AZ 5 Sa 483/20, Urteil vom 14.01.2021).
Fälle aus dem Arbeitsrecht betreuen in unserer Kanzlei in Lörrach die Rechtsanwälte Herwig Reissmann und Hannes Künstle. Vereinbaren Sie gerne einen Termin!
Trennung und Scheidung – was muss ich beachten?
Ein Scheidungsprozess ist sehr komplex und es gibt einige wichtige Punkte, die geklärt werden müssen – am besten in Ruhe vorab und mit juristischer Hilfe. Wir haben die wichtigsten Stichworte für Sie zusammengestellt:
- Wer reicht die Scheidung ein? Braucht jeder Partner einen Anwalt? Wie ist hier das Vorgehen? Welche Kosten kommen auf die Ehepartner zu?
- Gibt es eine gemeinsame Wohnung? Wer bleibt künftig darin wohnen, wer bezahlt die Miete und die laufenden Kosten? Wenn es die eigene Immobilie ist: Muss sie verkauft werden?
- Wie ist die Unterhaltsberechnung? Wer muss wieviel Unterhalt bezahlen? Was ist mit den eigenen Kindern? Wie hoch ist der Kindesunterhalt und wie lange muss er bezahlt werden?
- Wer bekommt das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder? Wo werden die Kinder künftig wohnen? Wie sind die Betreuungszeiten, z.B. an den Wochenenden und in den Schulferien? Welche Entscheidungen brauchen künftig die Zustimmung von beiden Elternteilen?
- Was passiert, wenn ein Partner stirbt? Muss ein Geschiedenentestament verfasst werden?
- Was ist mit den gemeinsamen Versicherungen, z.B. mit der Familien-Krankenversicherung? Wer kommt künftig für die Schuldentilgung auf, wer haftet?
- Was ändert sich steuerlich? Wenn die Steuerklasse gewechselt werden muss: Was ist mit eventuellen Steuernachzahlungen oder Steuererstattungen?
- Was ist mit dem gemeinsamen Besitz, z.B. dem Mobiliar der Wohnung? Wie wird der Besitz aufgeteilt, gibt es Entschädigungen für einzelne Gegenstände?
- Was passiert mit der Altersvorsorge? Mit den Rentenansprüchen? Bleiben diese bestehen oder müssen sie neu berechnet werden? Was passiert mit Betriebsrenten und privaten Rentenversicherungen?
- Wie hoch ist der Zugewinn und wie muss dieser ausgeglichen werden? Muss für den Zugewinnausgleich eventuell das eigene Unternehmen verkauft werden? Was ist mit Schenkungen und mit Erbe – werden diese auch hinzugerechnet?
- Muss eventuell eine Scheidungsfolgenvereinbarung abgeschlossen werden?
Sie sehen, es gibt eine Menge zu bedenken. In unserer Kanzlei in Lörrach steht Ihnen die Fachanwältin für Familienrecht Dagmar Hitzfeld mit Rat und Hilfe zur Seite. Vereinbaren Sie einen Termin!
Trennungskinder haben ein Recht auf Kontakt mit beiden Elternteilen
Wenn der Umgang mit den Eltern dem Kindeswohl dient, haben Scheidungs-, bzw. Trennungskinder ein Recht darauf, ihre Eltern regelmäßig zu sehen. Mit diesem Thema befasste sich das Oberlandesgericht Frankfurt in einem aktuellen Urteil (OLG Frankfurt am Main, AZ 3 UF 156/20, Beschluss vom 11.11.2020).
Wie war die Sachlage? Ein Ehepaar hatte drei Söhne und lebte seit 2017 getrennt – war aber noch nicht rechtmäßig geschieden. Beide Elternteile hatten das Sorgerecht. Die Söhne lebten bei der Mutter. Der Vater hatte eine neue Partnerin und war erneut Vater geworden. Das Leben mit einem Säugling ließ ihn nicht schlafen und außerdem habe er beruflich viel Stress – dies war seine Begründung, warum er seine Söhne nicht mehr treffen wollte.
Die Mutter der Kinder klagte, denn die Söhne vermissten den Vater und wollten ihn gerne sehen.
Vor Gericht bekam die Mutter Recht. Kinder haben ein Recht darauf, ihre Eltern zu treffen. Eine persönliche Beziehung zu beiden Elternteilen ist ganz wichtig für die Entwicklung der Kinder – vorausgesetzt, das Treffen diene dem Kindeswohl (§ 1684 Abs. 1 BGB). Elternsein beinhaltet die Pflicht, sich um seine Kinder zu kümmern und sie zu erziehen. Dies zu verweigern heißt, sich aus seiner Pflicht und seiner Verantwortung zu stehlen.
Die Richter ordneten im vorliegenden Fall an, dass der Vater seine Söhne einmal im Monat sonntags treffen und außerdem einen Teil der Schulferien mit ihnen verbringen müsse. Außerdem solle er darüber nachdenken, welche Prioritäten er im Leben setze und eventuell eine andere Gewichtung vornehmen.
In unserer Kanzlei in Lörrach ist Rechtsanwältin Dagmar Hitzfeld Ihre Ansprechpartnerin für alle Fälle aus dem Familienrecht. Vereinbaren Sie einen Termin!